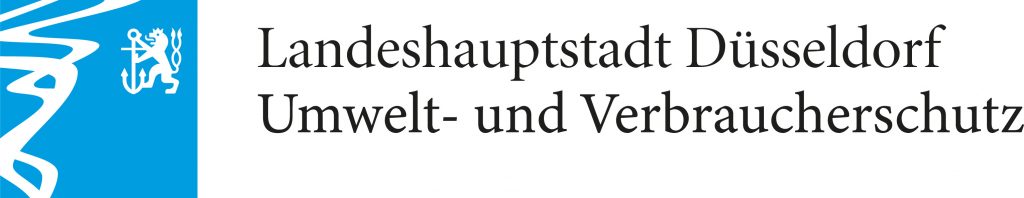Über Autokraten und Kornkammern
Lesezeit: 7 MinutenEin Möchtegern-Autokrat am Amazonas und die ehemalige Kornkammer Afrikas.
Wenn ich das Wort Agrarwende vor einem Jahr gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich nur mit den Schultern gezuckt. Zu wenig wusste ich über die Notwendigkeit einer eben solchen und zu wenig präsent waren mir die enorme Wichtigkeit über eine moderne und ökologische Landwirtschaft zu sprechen. Wenn man über Entwicklungspolitik spricht, dann ist die Brücke zur Agrarpolitik und zur Agrarwende offensichtlich – es sind aber dennoch andere Themen, die diskursbestimmend sind. Ich möchte in dieser Woche laut über die Möglichkeit einer Agrarwende nachdenken und angesichts der jüngsten Proteste unter dem Motto „Wir haben es satt!“ auch die Verknüpfungen zu Eine-Welt-Themen ziehen, die mir bislang aufgefallen sind.
Wie belohnt man eigentlich einen egozentrischen Möchtegern-Autokraten, wie ich ihn nennen würde, der den Amazonas abholzt und niederbrennen lässt, Corona konsequent verharmlost und bei Menschenrechten des Öfteren eine sehr selektive Wahrnehmung von Universalität und Unteilbarkeit hat? Die Belohnung trägt den Namen „EU-MERCOSUR-Abkommen“. Doch es steht in der Kritik und ich finde: Zurecht! Für immer weitere Weideflächen und Monokulturanbau wird der Amazonas und weitere Wälder vor Ort gerodet, die weltweite Entwaldung könnte dadurch massiv beschleunigt werden. Das Abkommen bietet vor allem Herstellern von Pestiziden lukrative Vorteile. Wenn selbst ausgewiesene Freihandelsexpert*innen Zweifel hegen, möchte das schon was aussagen. Eine Agrarwende ist eine Kehrtwende, die sich auch weg von Monokulturen bewegen muss. Ökologische Standards jedenfalls dürfen bei ökonomischen Erwägungen nicht außen vor gelassen werden. Die Zeche zahlen ansonsten am Ende Menschen, die für die Fehler, die hier und heute gemacht werden nichts können. Das kann und das darf nicht das Ergebnis sein.
Im Globalen Süden ist im Übrigen noch ein beträchtliches Potenzial an umweltschonender Landwirtschaft und Ackerbau ungenutzt. Dabei geht es nicht nur, aber auch, um die ungleiche Verteilung von Land, die schlechte Bewirtschaftung, die schlechte Wasserversorgung und das fehlende Know-How. Ein Blick nach Simbabwe zeigt uns beispielsweise, wie schnell durch politisches Versagen Potenziale ungenutzt bleiben und Menschen verarmen und verelenden können. Einst als Kornkammer Afrikas gefeiert, ist die Situation in Simbabwe mittlerweile meilenweit von Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit entfernt. Im Welthungerindex liegt Simbabwe weit zurück. Eine Landreform Anfang der 2000er-Jahre enteignete in massenhaften Stile Landbesitzer*innen und schrieb diese in einem Akt nahezu beispielloser Vetternwirtschaft Vertrauten der Mugabe-Regierung zu – entschädigungslos. Diese neuen Besitzer*innen hatte nicht nur wenig Ahnung von Viehzucht und Ackerbau. Viele simbabwische Communities fanden auf den großen Farmgebieten Anstellung. Die Folge der Landreform: Die landwirtschaftliche Produktion brach ein. Das hätte nicht sein müssen. Mittlerweile plagt das Land Hungersnöte und viele leiden an einer grausame Mangel- und Unterernährung. Diese desolate Lage ist politisch verschuldet, dabei kann man nicht sagen, dass es so hätte kommen müssen.
Auch hier sieht man wieder die altbekannte Differenz zwischen Potenzial und Realität. Wenn es um Ernährungssicherheit und um Ernährungssouveränität geht, dann müsste es unser Anspruch sein, in einem gemeinsamen Verbund viel stärker gegen Hunger und Armut zu kämpfen. SDG 1 (Keine Armut) und SDG 2 (Kein Hunger) sind elementare Verbesserungen, denen wir uns verschreiben müssen. Und die SDGs sind die Aufgabe aller, sie sind ein globales Projekt. Vermutlich müsste kein Kind dieser Welt hungern, wenn man die Ressourcen vernünftig bündeln würde, wenn man die Wasserprobleme in vielen Staaten des Globalen Südens in den Griff bekäme, wenn man die Mittel bereitstellt, um Know-How und um Infrastruktur zu schaffen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Wie Jean Ziegler sagte:
“Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.”
Das Schöne ist dabei auch noch, dass diese Welt ohne Hunger mit einer Landwirtschaft, die wieder effizient und effektiv für Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität sorgt, gar auf umweltschonenden Ressourcen bündeln könnte. Eine Welt ohne Hunger kann auch eine Welt sein, in der es verpönt ist, mit Saatgut zu spekulieren, in der Landwirtschaft und Ackerbau als eine der wichtigsten Versorgungsquellen im Globalen Süden anerkannt wird, die Ressourcen und Infrastruktur bereitgestellt worden ist und in eine nachhaltige Zukunft gestartet werden kann. Eine Welt ohne Hunger ist keine Utopie, sondern ein dringendes und tatkräftiges Ziel und wir sollten uns alle daran machen, auch dieses Mal wieder dafür zu sorgen, dass dieses Ziel nicht in der Versenkung verschwindet – denn zwischen Agrarwende und Ernährungssicherheit liegt eine wundervolle Synergie. Wir müssen sie nur zu nutzen wissen und sie einsetzen. Damit es in ein paar Jahre keinen Menschen mehr gibt, der hungern muss – egal, ob er von einem Möchtegern-Autokraten regiert wird, in der ehemaligen „Kornkammer Afrikas“ oder sonst irgendwo auf diesem Planeten lebt.