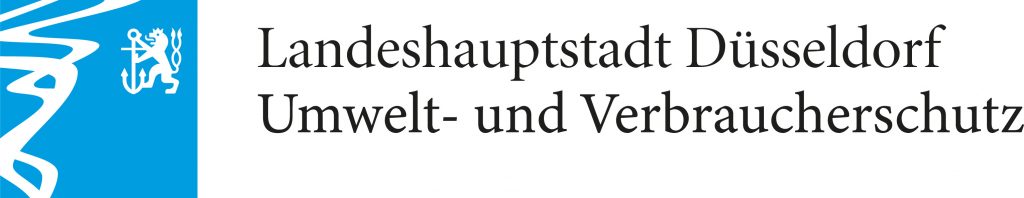„Man wird doch wohl noch Spaß haben dürfen!“ – Kulturelle Aneignung im Karneval
Lesezeit: 9 Minuten0
Ein Kommentar von Stephanie Widholm
Endlich geht’s wieder los, die närrische Zeit beginnt – bestickte Ponchos, Federschmuck, Sombreros, spitze Hüte, Kimonos oder Saris: Viele verschiedene Kostüme werden in wenigen Wochen das Stadtbild prägen und die Herzen aller Jecken mit Frohsinn und Freude erfüllen. Die Herzen aller Jecken? Daran darf man getrost seine Zweifel haben.
Manch eine*r wird zorneserfüllt die Luft anhalten oder zumindest gepflegt die Augen verdrehen, wenn ich mich an dieser Stelle dem Begriff der „Kulturellen Aneignung“ annehme. „Ach nee, nicht schon wieder!“, mag da Manche*r denken oder sagen und ich sage: „Ja doch, schon wieder!“. Mir wäre es ja auch lieber, wenn die Problematik, die mit der ein oder anderen Karnevals-Kostümierung einhergeht, nicht gebetsmühlenartig wiederholt werden müsste. Aber so richtig angekommen ist die Botschaft offensichtlich noch nicht.[1] Daher: Willkommen in meinem kleinen Servicebeitrag zum Thema „Kulturelle Aneignung im Karneval“!
Schauen wir doch erstmal auf ein paar typische Aussagen der Närrinnen und Narren, die sich in Sorge vor Cancel Culture und Moralpolizei wähnen oder die zumindest die Notwendigkeit einer Debatte über „Kulturelle Aneignung“ überhaupt nicht sehen.
Man wird doch wohl noch Spaß haben dürfen!
Die fünfte Jahreszeit, endlich wieder Zeit, zu singen und zu schunkeln, zu bützen und einfach jeck zu sein, bis der Arzt kommt. Karneval ohne Spaß: Geht nicht, macht niemand, ergibt keinen Sinn. Aber seien wir doch mal ehrlich: Um wessen Spaß geht es denn hier? Um den Spaß aller oder vor allem um meinen eigenen Spaß mit zeitgleichem Ausklammern karnevalistischer Werte[2]? Und: Haben wir etwa keinen Spaß an den jecken Tagen, wenn wir uns im Vorfeld für zwei Sekunden Gedanken machen, welche Kostümierung wir wählen? Laufen uns die Tränen der Trauer herab, wenn wir das Mexikaner-Kostüm im Schrank lassen (oder noch besser: entsorgen) und uns stattdessen eine Clownsnase überstülpen? Kann ich mir kaum vorstellen. Und ist es letztlich nicht sogar viel spaßiger, wenn man weiß, dass sich alle Jecken, egal wo sie herkommen oder wo ihre kulturellen Wurzeln liegen, sich von meinem Auftreten nicht verletzt, sondern respektiert und wohl fühlen? [3]
Eigentlich zeigen wir damit doch, wie sehr wir andere Kultur wertschätzen!
Kulturelle Aneignung – kulturelle Wertschätzung: Hört sich ähnlich an, unterscheidet sich aber ganz wesentlich voneinander. Auf einer Webseite der University of British Columbia wird der Unterschied zwischen kultureller Wertschätzung und kultureller Aneignung recht prägnant beschrieben. Demnach ist mit kultureller Wertschätzung verbunden, die eigene Perspektive zu erweitern und sich mit anderen kulturübergreifend zu verbinden, während kulturelle Aneignung bedeutet, einen Aspekt einer Kultur zu übernehmen, der nicht der eigenen entspricht, wie z. B. Gegenstände oder Praktiken, und ohne Zustimmung oder irgendeinen kulturellen Kontext oder eine Beziehung zu diesem Gegenstand oder dieser Praxis nachzuahmen. Und zwar ausschließlich aus persönlichem oder kapitalistischem Interesse, um an Popularität zu gewinnen oder weil es einem schlichtweg gefällt.[4] Das heißt: Wenn ich mir zum Beispiel einen Sari anziehe (und dabei vielleicht noch fleißig mit dem Kopf wackle und Currypulver verstreue), einfach weil ich es irgendwie lustig oder schön oder aufregend finde, hat das null mit kultureller Wertschätzung zu tun. Null.
Früher hatte man damit auch kein Problem!
Ja, früher… Früher wurden auch Hexen verbrannt, Kinder nach Lust und Laune verprügelt, Frauen in der Ehe straflos vergewaltigt und Homosexualität kriminalisiert. Es mag natürlich Menschen geben, die diesen oder anderen üblen Artefakten der Vergangenheit hinterhertrauern, aber dem Großteil der hier Mitlesenden möchte ich unterstellen, dies nicht zu tun. Also, kurz und knapp: Veränderungen irritieren, Veränderungen sind manchmal auch anstrengend, aber Veränderung ist nichts, was uns Angst machen sollte. Vor allem dann nicht, wenn es um Veränderungen hin zu einer Gesellschaft geht, die es ernst meint mit unseren demokratischen Grundwerten und mit dem Abbau von Ungleichheiten und Diskriminierung.
Immer diese linke Identitätspolitik, Wokeness, Cancel Culture! Heutzutage darf man ja gar nichts mehr…
Den aus meiner Sicht härtesten Tobak habe ich mir für den Schluss aufbewahrt. Es ist schon furchteinflößend-faszinierend, wie von mancher Seite aus fast schon gewohnheitsmäßig mit einem „Heutzutage darf man auch gar nichts mehr sagen!“ auf jeglichen Hinweis auf oder – oha! – gar Kritik von Diskriminierung, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, Antisemitismus oder Sexismus reagiert wird. Eine Randnotiz soll mir daher erlaubt sein: Es weckt große Sorge in mir, wie bisweilen auf Menschen, die zum Beispiel diskriminierende Strukturen sichtbar machen und anprangern, reagiert wird. Wie diese Menschen als „Mob“ bezeichnet werden, wie von „linker Bedrohung“ oder „Meinungsdiktatur“ gesprochen wird. Leute: Baut keine Bedrohungsszenarien auf, wo es keine Bedrohung gibt. Letztendlich heizt ihr nämlich damit nur der Ofen derjenigen an, denen ihr es doch bitte ganz gewiss nicht gemütlich machen wollt: Nämlich rechten Verschwörern und Extremisten.
Also, zurück zur gepflegten Debatte, schauen wir doch nochmal ein wenig differenzierter darauf, um was es beim Umgang mit „Kultureller Aneignung“ geht und um was es auch nicht geht bzw. gehen sollte:
Nein, es geht nicht darum, die Hybridität von Kulturen und Identitäten grundsätzlich zum Teufel zu jagen. Wer zum Salsa-Kurs geht, indigene Stickereien sammelt, sich für afrikanisches Theater interessiert oder gerne aus japanischen Kochbüchern kocht und dies mit Interesse und Wertschätzung für die entsprechende kulturelle Praxis tut, der soll das unbedingt weiter machen!
Nein, es geht nicht darum, als Ethik-Polizei auf Streife zu gehen und allen Sombrero-Behuteten an Karneval den Gummiknüppel über den Schädel zu wummern. Es geht auch nicht darum, mit ausgetrecktem Finger auf den einzelnen Unbedarften zu zeigen. Es geht darum, die Perspektive von BIPoC sichtbar zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass es zum Beispiel für Native Americans äußerst verletzend sein kann, wenn Jürgen Ketlinski mit Federschmuck daher kommt[5]. Nur wer über die Problematik Bescheid weiß, kann seinen bzw. ihren eigenen Umgang damit reflektieren und gegebenenfalls auch ändern. Wenn wir Stimmen von marginalisierten Gruppen oder Minderheiten ausschließen, nicht hören oder nicht hören wollen, wenn wir den Wunsch nach Anerkennung der eigenen Lebensrealität, Tradition oder des eigenen Erfahrungshintergrundes nur für uns selbst gelten lassen – dann führt das in Wirklichkeit nur zu Spaltung, Desinteresse und mangelnder Empathie füreinander, nicht zu mehr „Freiheit“.
Nein, es geht nicht darum, Einzelne zu shitstormen oder irgendwelche Kostüme zu „verbieten“ (wer auch immer so ein Verbot aussprechen sollte). Es geht darum, dass wir als Gesellschaft aushandeln müssen, ob wir es weiterhin als selbstverständlich nehmen möchten, anderen Menschen zu nahe zu treten oder sie gar in ihrem Stolz und ihren Gefühlen zu verletzen. Es geht um das Infragestellen von Strukturen und um die Frage, an welchen Werten wir unsere Institutionen, unser Zusammenleben und ja, auch unser Brauchtum ausrichten möchten.
In einer weltoffenen und internationalen Stadt wie Düsseldorf müssen sich alle Akteur*innen fragen, welche Rolle sie einnehmen können und wollen, damit Minderheiten und marginalisierte Gruppen sich nicht ausgeschlossen oder gar verletzt oder diskreditiert fühlen (oder sogar: Damit sie sich mitgenommen und einbezogen fühlen!?). Vor allem diejenigen, die für den Karneval in Düsseldorf Verantwortung übernehmen, die planen, organisieren, Strukturen schaffen, die sichtbar sind und gehört werden – diejenigen sollten nicht müde werden, Haltung zu zeigen, Perspektiven von Betroffenen ernst zu nehmen und die Bedeutung des Themas nicht kleinzureden.
Als ich vor einigen Jahren aus Bayern nach Düsseldorf gezogen bin, war ich sofort Feuer und Flamme für die jecke Zeit. Denn der Karneval in Düsseldorf versucht zu integrieren und mitzunehmen und der Karneval in Düsseldorf hat auch keine Angst, sich gegen undemokratische Tendenzen zu stellen und Ungerechtigkeit zu benennen. Das hat mich schwer beeindruckt und sogar ein bisschen stolz gemacht, weil ich irgendwie ein Teil davon war. Jetzt bloß nicht nachlassen, liebes Düsseldorf, bloß nicht nachlassen!
[1] BILD online: Kölner Kult-Clown ledert gegen Witze-Zensur, https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/karnevalssitzung-in-duesseldorf-koelner-kult-clown-ledert-gegen-witze-zensur-82537606.bild.html (17.01.2023)
[2] Ethik-Charta des Bundes Deutscher Karneval e.V., https://karnevaldeutschland.de/wp-content/uploads/2019/09/BDK_Ethik_Charta_A3.pdf (17.01.2023)
[3] Vice: Ich bin „echter“ Indigener und finde eure Indianer-Kostüme nicht witzig, https://www.vice.com/de/article/zma8ze/liebe-deutsche-indianer-kostume-an-karneval-sind-nicht-lustig (17.01.2023)
[4] The University of British Columbia: What does it mean to appreciate vs. Appropriate culture?, https://vpfo.ubc.ca/2021/10/what-does-it-mean-to-appreciate-vs-appropriate-culture/ (17.01.2023)
[5] Native American Association of Germany e.V.: Stereotypen und „Indianer“- Kostüme. Aus den Blickwinkeln von Native Americans heraus betrachtet, https://www.naaog.de/Deutsch-German/Stereotypen-und-Indianer-Kostueme/index.php/ (18.01.2023)